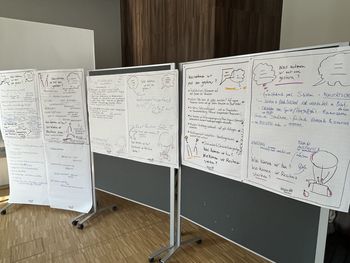Resilienz stärken
Vom 10. bis 11. März 2025 lud die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (et) gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit, der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus sowie der Diakonie Deutschland zur Fachtagung „Resilienz stärken“ in das Erfurter Augustinerkloster ein. Das Thema: Welche Folgen haben ein zunehmender Rechtsextremismus, Rassismus, Populismus und Demokratieskepsis für die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und politische Jugendbildung?
Ein besonderer Mehrwert der Tagung lag darin, durch die Kooperation mehrerer evangelischer Akteure unterschiedliche Handlungsfelder zusammenzubringen und zu einer multiperspektivischen Betrachtung der Herausforderungen anzuregen, wie Judith Jünger (BAG EJSA) eingangs hervorhob. Die Tagung bot eine Plattform zur Vernetzung zwischen den einzelnen Arbeitsfeldern sowie zwischen regionalen Perspektiven in einem bundesweiten Kontext. Ziel sei es, so Ole Jantschek (et), Herausforderungen nüchtern zu analysieren, aber auch voneinander zu lernen und aus der Tagung mit konkreten Tipps, mit einem Zuwachs an Orientierung und gegenseitiger Bestärkung nach Hause zu gehen. Der Ort der bundesweiten Tagung war dabei bewusst gewählt, wie Henning Flad (Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus) gleich zu Beginn konstatierte: „Thüringen ist eine Hochburg der extremen Rechten. Es ist wichtig, sich von so etwas nicht verscheuchen zu lassen.“ Dies war auch keineswegs der Fall, denn rund 80 Interessierte aus den vielfältigen Bereichen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und politischen Jugendbildung waren der Einladung gefolgt.
Die frühlingshafte Atmosphäre im historischen Augustinterkloster mochte dabei nicht so recht zur oftmals betretenen Stimmung passen, die insbesondere am ersten Tag zu spüren war. David Begrich (Arbeitsstelle Rechtsextremismus, Miteinander e.V.) zeichnete ein düsteres Bild der Lage: Entgegen häufiger politikwissenschaftlicher Einschätzungen setze sich die AfD durch, je radikaler sie auftritt, nicht wo sie gemäßigt erscheint. Ihr Mobilisierungsreservoir sei noch nicht erschöpft, wie vergangene Wahlen gezeigt hätten. Auf kommunaler Ebene sei die Brandmauer an vielen Stellen gefallen, auf Landesebene sei es eher eine Frage der Zeit. Daher müsse es darum gehen, Strukturen und Träger gegen zukünftige Angriffe abzusichern.
Romy Arnold (Mobile Beratung in Thüringen) berichtete, dass sich ihre Arbeit verändere: In den vergangenen Jahren beobachte sie insbesondere bei Jugendlichen einen verstärkten Rechtsruck, statt um Einzelfälle handle es sich inzwischen oftmals um ganze Klassenverbände zzgl. Eltern und Lehrerkollegium. „Resilienz“, so ihre Einschätzung, „bedeute mit dem Rechtsruck zu leben, ohne ihn zu akzeptieren“. Johanna Schäfer (ezra, Opferberatung Thüringen) ergänzte diesen Eindruck um anschauliche Erfahrungsberichte von Betroffenen rechter Gewalt und hob hervor, dass sie eine besorgniserregende Abnahme solidarischer Räume beobachte. Samuel von Frommannshausen (CJD) betonte die Notwendigkeit, mehr Menschen zu aktivieren und Dialoge von der politisch-ideologischen Ebene auf die persönlich-betroffene zu überführen; dafür brauche es Orte und Formate. Als positives Beispiel wurde hierfür auch die Kirche genannt, welche gerade im ländlichen Raum einen wichtigen Faktor darstelle, indem sie Räume zum Austausch und für Gemeinschaften biete. Özcan Karadeniz (DEZIM) arbeitete in seinem Vortrag die Notwendigkeit heraus, Rassismus zu verstehen und empirisch zu erfassen, um darauf angemessen reagieren zu können.
Am zweiten Tag boten vier Workshops die Möglichkeit, Einblicke in praktische Ansätze zu erhalten und sich intensiv auszutauschen. So ging es u.a. darum, wie politische Bildung mittels Forumtheater auch schwierige Themen aufgreifen kann, welche Handlungsspielräume es für die Jugendarbeit auf TikTok gibt und was für die Gestaltung niedrigschwelliger Dialogformate vor Ort wichtig ist. Auch eine kritische Lektüre rechter Texte stand auf dem Programm.
Gemeinsam erarbeiteten die Teilnehmenden in kleineren Gruppen zum Abschluss Handlungsmöglichkeiten. Ein Fazit dabei: Für die Resilienz als Fachkräfte ist es wichtig, sich neben allen Herausforderungen auch über Erfolge und Beispiele guter Praxis auszutauschen. Denn es macht Mut zu wissen, dass man nicht alleine steht und viele andere sich engagieren. Daher sind auch Träger und ihre Leitungen gefragt, klar Position zu beziehen und Fachkräften den Rücken zu stärken.